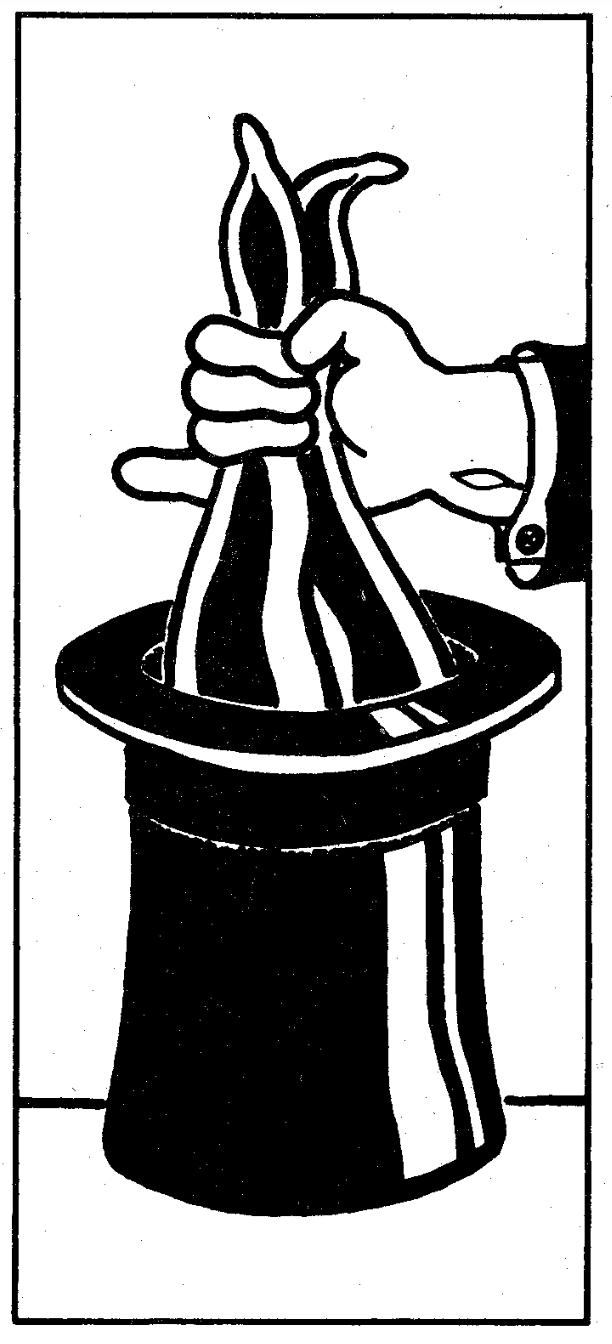In der politischen Diskussion werden der österreichischen Verfassung "Grundwerte" angedichtet, die sie gar nicht enthält. Dort, wo die Verfassung eindeutig politische Entscheidungen vorgibt - etwa für eine antifaschistische Republik oder ein neutrales Österreich - werden diese allerdings gerne übersehen.
Es scheint hilfreich, die Sache langsam anzugehen: Was "Werte" sind, ist zwar weitestgehend ungeklärt und heftig umstritten. In der allgemeinen Diskussion haben sich freilich nicht die Feinheiten und akademischen Sophismen durchgesetzt, sondern eher pragmatische Bestimmungen. Werte sind dann, um einer Definition von Friedrich (Werte und soziales Handeln, Tübingen 1968, S 113) zu folgen, bewusste oder unbewusste Vorstellungen des Gewünschten, die sich in Präferenzen bei der Wahl zwischen Handlungsalternativen niederschlagen. In den inzwischen modisch gewordenen Jargon der Systemtheorie übersetzt, hieße das dann, dass es auf sehr verschiedene Weise und für durchaus verschiedene Interaktionskonstellationen in all diesen Fällen darum geht, die Auswahl der Kommunikation so zu konditionieren, dass sie zugleich als Motivationsmittel wirken, also die Befolgung des Selektionsvorschlages hinreichend sicherstellen, wie Luhmann (Soziale Systeme, Ffm 1987, S 434) meint.
Mit dieser Bestimmung kann man arbeiten - und es lässt sich auch schnell skizzieren, welche Bedeutung solchen "Werten" in der Verfassungsdiskussion zukommt: Verfassungstexte und Gesetze überhaupt sind auf Veränderung beziehungsweise auf Abänderbarkeit ausgerichtet; sie müssen - sollen sie "gut" sein, das heißt ihre spezifische "Eigenleistung" erbringen - oft sehr komplex und in Details instabil sein. Daraus ergibt sich, die Juristen wissen, eine gehörige Portion "Zufälligkeit". Ein einmal erzielter "Wertkonsens" erleichtert die Kommunikation über die weitere Rechtsentwicklung, über die situative Adaptierung der Normen et cetera. Man kann also durch einen derartigen Wertkonsens den anstehenden Problemen dadurch Herr werden, dass man in der Kommunikation unbestreitbare (oder: sehr schwer bestreitbare, durch Moralisierung gedeckte) Ausgangspunkte benutzt und gleichzeitig auf die Erwartung baut, dass dann zumindest jedermann zustimmen müsste. Es lassen sich sehr schnell Beispiele aus dem juristischen Alltag beibringen, wo das Einverständnis über eine ins Auge gefasste "juristische Lösung" nicht in konkreter Kenntnis der Rechtslage, sondern in der gemeinsamen Antizipation des gewünschten Ergebnisses liegt. "Werte" dienen dann, um erneut Luhmanns (ebd.) affirmative Diagnostik zu bemühen, "wie eine Art Sonde, mit der man prüfen kann, ob auch konkrete Erfahrungen funktionieren, wenn nicht allgemein, so doch jedenfalls in der konkreten Situation ... "
Bild 1"Wertneutral" hieße in Fortsetzung dieser Bestimmung, dass es gerade an allgemeinen und vom konkreten Zusammenhang losgelösten Gesichtspunkten des Vorziehens von Zuständen oder Ereignissen ermangelt. Es fehlt dann eben, um die Definition von Friedrich noch einmal aufzunehmen, eine gemeinsame "Vorstellung des Gewünschten"; es gibt einfach keine Vorlieben bei der Wahl zwischen Handlungs- und/oder Interpretationsalternativen.
Entgegen der oftmals veranstalteten Klage in Sachen "Wertverfall" ist das für sich genommen gar nicht weiter schlimm, weil ja entgegen einer weitverbreiteten Meinung aus bloßer Wertung nichts für die Richtigkeit der Handlung oder Interpretation zu gewinnen ist. Das würde eine allgemein anerkannte Wertordnung, das heißt eine logische Rangordnung einer (sachlich unbeschränkbaren) Vielzahl von Wertungen voraussetzen; so etwas gibt es nicht. "Wertneutral" in Bezug auf einzelne verfassungsrechtliche Bestimmungen und den ganzen Verfassungstext meint dann, dass es keine relevante Differenz zwischen "Wert" und Verfassung(snorm) gibt; oder anders: was an "Wert" da ist, dürfte in der Verfassung bloß die Grundlage weiterer Entwicklung finden und nicht schon offene oder versteckte Wegweiser. Von "wertneutralen" Bestimmungen lässt sich also dann reden, wenn ihr spezifischer rechtlicher Gehalt erkennbar darauf gerichtet ist, nicht als "Vorstellung des Gewünschten" für eine andere Norm zu fungieren. "Wertneutralität" heißt dann aber auch, dass sich - jetzt quasi von der anderen Seite - eine Norm weigert, zum Objekt von "außen" an sie herangetragener allgemeiner Gesichtspunkte zu werden.
Ein ganz einfaches Beispiel mag das illustrieren: Der Artikel 36 B-VG sieht in seinem Absatz 1 vor, dass die Länder im Vorsitz des Bundesrates halbjährlich in alphabetischer Reihenfolge wechseln. Diese Norm gibt als eine ihren konkreten Anwendungsfall transzendierende "Vorstellung des Gewünschten" wenig her; sie ist erkennbar ein Regelungsmodell, dem sich mit einiger Plausibilität andere gegenüber stellen ließen. Deutlich wird, dass sich darin eben kein Wert ausdrückt (statt "alphabetischer Reihenfolge" wäre gleichwertig eine Reihung nach Einwohnern möglich etc.), sondern schlichte Regelungspragmatik, die den geordneten politischen Streit ermöglichen und sichern helfen soll. Auf der anderen Seite gibt diese Norm auch nicht viel her, wenn ihre Werte appliziert werden sollten; der spezifische Regelungsinhalt des Art. 36 B-VG ist etwa vollkommen indifferent gegenüber bestimmten Vorstellungen von "Bundesstaatlichkeit"; es fehlt offensichtlich an einer "Eingangspforte" für allgemeine Gesichtspunkte, wie sie etwa sogenannte unbestimmte Gesetzesbestimmungen, Verweisungen etc. darstellen.
Als "wertneutral" lässt sich eine Verfassung also dann bezeichnen, wenn sie in Summe beiden Erfordernissen genügt: Ihre Normen müssten im Großen und Ganzen präzise genug sein, um nicht dauerndes Objekt von Be-Wertungen zu sein; und ihre einzelnen Bestimmungen müssten sich als vollkommen untauglich erweisen, um aus ihnen heraus Aufgaben- und Zielstellungen zu gewinnen, die sich dann (nur) in der Anwendung bzw. Interpretation anderer Normen realisierten.
Bild 2Nun lehrt ein Blick auf das geltende Verfassungsrecht, dass von einer "Wertneutralität" nur in einem sehr spezifischen und genauer zu umschreibenden Sinne gesprochen werden kann. Die ältesten Teile der Verfassung, also die Grundrechtsbestimmungen des Staatsgrundgesetzes aus dem Jahre 1867 waren ja der explizite Versuch des (schwachen) österreichischen Bürgertums, "allgemeine Rechte der Staatsbürger" (so der Titel des StGG) zu fixieren, also gerade mit der Absicht konzipiert, allgemeinen Einfluss auf die "besonderen" Gesetze sicherzustellen. Die gesellschaftspolitischen Leitvorstellungen wurden zunächst übersetzt in Rechtsforderungen und diese fungierten nach ihrer Verkündung als Rechtsnormen, d.h. als (zumindest teilweise und tendenziell darauf ausgerichtete) sanktionsbewehrte Zwangsregeln. Durch Einhaltung der Grundrechte sollte es quasi von selber zur Herstellung des "Gewünschten" kommen.
Dabei waren die durch Verfassungsnormen dargestellten Werte zunächst recht einfach: Formale Rechtsgleichheit aller Untertanen "vor dem Gesetz" (Art. 2); gleicher Zugang zu den Staatsämtern (Art. 3); Freizügigkeit der Person und des Vermögens (Art. 4); Unverletzlichkeit des Eigentums (Art. 5); Freiheit der Erwerbstätigkeit (Art. 6); Aufhebung persönlicher Abhängigkeit und Grundbefreiung (Art. 7) etc. etc. Insgesamt war das StGG ein moderat gehaltenes Programm zur Beendung feudalmonarchischer Bevormundung; es war ausgerichtet auf die Herstellung jener Bedingungen, die eine kapitalistische Geldwirtschaft zu ihrem Funktionieren bedurfte. Der Glanz von 1789 war verflogen, der Jakobiner hatte man sich schon früher entledigt - und was übrig blieb war nicht mehr als ein Bündel von Bestimmungen, das sicherstellen sollte, dass der Staat die Gesellschaft (also die Bürger) in Ruhe lässt. Der "bescheidene" Wert des StGG lässt sich übrigens schon daran ablesen, dass es von Kaiser Franz-Joseph erlassen und angeordnet, wohingegen die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 der Erkenntnis und Erklärung der sich selbst konstituierenden Nationalversammlung geschuldet worden war!
So gesehen sind die Bestimmungen des StGG. soweit sie sich noch heute in Geltung befinden, nicht so sehr der Ausdruck bestimmter "Werte" (das natürlich auch), sondern die Festschreibung unabdingbarer Minimalpositionen erwerbs- und profitorientierter Wirtschaftsbürger; dass die Befestigung und der Ausbau dieser Positionen auch einer darüberhinausgehenden wertmäßigen Verankerung bedurfte, und dass aus diesem Grund immer wieder versucht wurde, die Ziele als "natürlich", "unveräußerlich", "grundlegend" und "gerechte Forderung" zu präsentieren, versteht sich. Es gelingt eben nur durch eine gewisse Geschlossenheit des ideologischen Systems, durch die Formierung des Bewusstseins auf bestimmte "Grundwerte" - die nicht nur für das Recht, sondern für das gesamte politische und soziale Sein gelten sollten - die Ideen der Herrschenden zu den herrschenden Ideen werden zu lassen.
Man darf nicht übersehen, welche kostbare Veredelung sich an diesen Grundrechten zwischenzeitig vollzogen hat: Wenn heute etwa Korinek immer wieder behauptet, dass Art. 5 StGG "eine Garantie der Unverletzlichkeit des Eigentums als Institutsgarantie und subjektives, verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht" ist, und dass diese "Gewährleistung des Eigentums zu den tragenden Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung und unseres Wirtschaftssystems (zählt)", dann ist dies eine apriorische Erdichtung der Geschichte (Vgl. bloß Korinek, Grundrechte und Wirtschaftsordnung, in: Wirtschaft und rechtliche Schranken, hrsg. von der Österr. Juristenkommission, Wien 1989, S. 89ff, hier S. 92). Und in geradezu vorbildlicher Weise werden durch eine solche Argumentation aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Gegenwart Maßstäbe zur Auslegung der Normen des StGG abgeleitet; demgegenüber ist daran festzuhalten, dass der Normgehalt von (Verfassungs-)Gesetzen, der mit dem Willen des historischen Gesetzgebers identisch ist, nur durch Verfassungsänderungen verändert werden kann. Und von einem "Wesen des Privateigentums", vom "öffentlichen Wohl" und dem "allgemeinen Besten" lesen wir im StGG nichts; das ist eine Rechtserfindung des VfGH (vgl. VfSlg. 8981/1980 - "Rückübereignungserkenntnis"). Mit anderen Grundrechten des StGG (etwa dem Art. 6) wird zwischenzeitig dasselbe betrieben: Indem das Grundrecht auf Privateigentum, Freiheit der Erwerbstätigkeit etc. zur Institutsgarantie erhoben wird, entzieht man es dem Zugriff des demokratisch legitimierten Gesetzgebers. - Dass es mit dieser demokratischen Legitimation nicht zum Besten steht, ist dann ein anderes Thema.
Die (bürgerlichen) Ergebnisse des StGG wurden durch das B-VG gefestigt bzw. ausgebaut. An die Seite der liberalen Abwehrrechte gegen den Staat trat die Volkssouveränität als "ÜberWert". "Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.", sagt Art. 1 B-VG. Schon in der Formulierung zeigt sich freilich eine gewisse Reserviertheit gegenüber demokratischer Volksherrschaft. In der schon zitierten Menschen- und Bürgerrechtserklärung des Jahres 1789 hatte es in Art. 3 noch geheißen: "Der Ursprung aller Souveränität liegt seinem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft, kein einzelner kann eine Autorität ausüben, die nicht ausdrücklich hiervon ausgeht". Während also in der Französischen Menschenrechtserklärung die Volkssouveränität noch ganz deutlich als Rechtswert zu erkennen ist, stellt sich Art. 1 B-VG als nüchtern gefasste kontrafaktische Unterstellung dar, die für die Anwendung auf andere Normen des Verfassungsrechts (eben als "Wert") nicht viel hergibt. Und während dementsprechend die Französische Menschenrechtserklärung als Korrektiv zu demokratiewidriger Autoritätsanmaßung das "natürliche und unabdingbare Menschenrecht ... (auf) Widerstand gegen Unterdrückung" setzte (Art. 2), blieb im B-VG (als streng formellen Recht Kelsen'scher Prägung) nur noch die Beschreitung des Rechtsweges; man darf den auf gesellschaftlichen Frieden zielenden Charakter dieser Entwicklung freilich nicht gering erachten, auch wenn der Übergang der Kontrolle über das "richtige" Recht vom Volk auf die Justiz immerhin Beachtung verdient.
Während sich im StGG jene Werte ausdrückten, die vorgeblich "allgemeine Rechte der Staatsbürger" waren, schien eine Verankerung weiterer (außerhalb des unmittelbaren Verfassungstexter liegender) Werte 1920 entbehrlich bzw. nicht möglich: Spätestens mit der Konstituierung der Arbeiterklasse auch als politische Partei waren Illusionen "allgemeiner Werte" dahin und weder Sozialdemokratie noch Christlichsoziale waren stark genug, ihren Werten letztlich zum Durchbruch zu verhelfen. Mit Art. 149 B-VG setzte man jedenfalls die "alten Grundrechte" erneut in Geltung, unterstellte diese gleichzeitig dem "Wert" der Demokratie (Art. 1) und hielt so insgesamt die weitere gesellschaftliche Entwicklung offen. Natürlich druckt sich aber auch in der bewussten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Indifferenz des B-VG ein bestimmter "Wert" aus, der sich bei der Interpretation bestimmter Normen des Verfassungstextes darin äußern müsste, dass eben kein bestimmtes Ergebnis von vorneherein ausgeschlossen werden darf. Was dies für aktuelle verfassungspolitische Diskussionen heißt, müsste weiter diskutiert werden. Und die Frage, ob nicht etwa das Verbotsgesetz (StGBl. 13/1945), das Parteiengesetz (BGBl. 211/1955) sowie der Beitritt Österreichs zur EMRK (BGBl. 59/1964) doch eine wertmäßige Ausrichtung unserer Verfassung bewirkt haben, würde sich dann auch beantworten lassen.